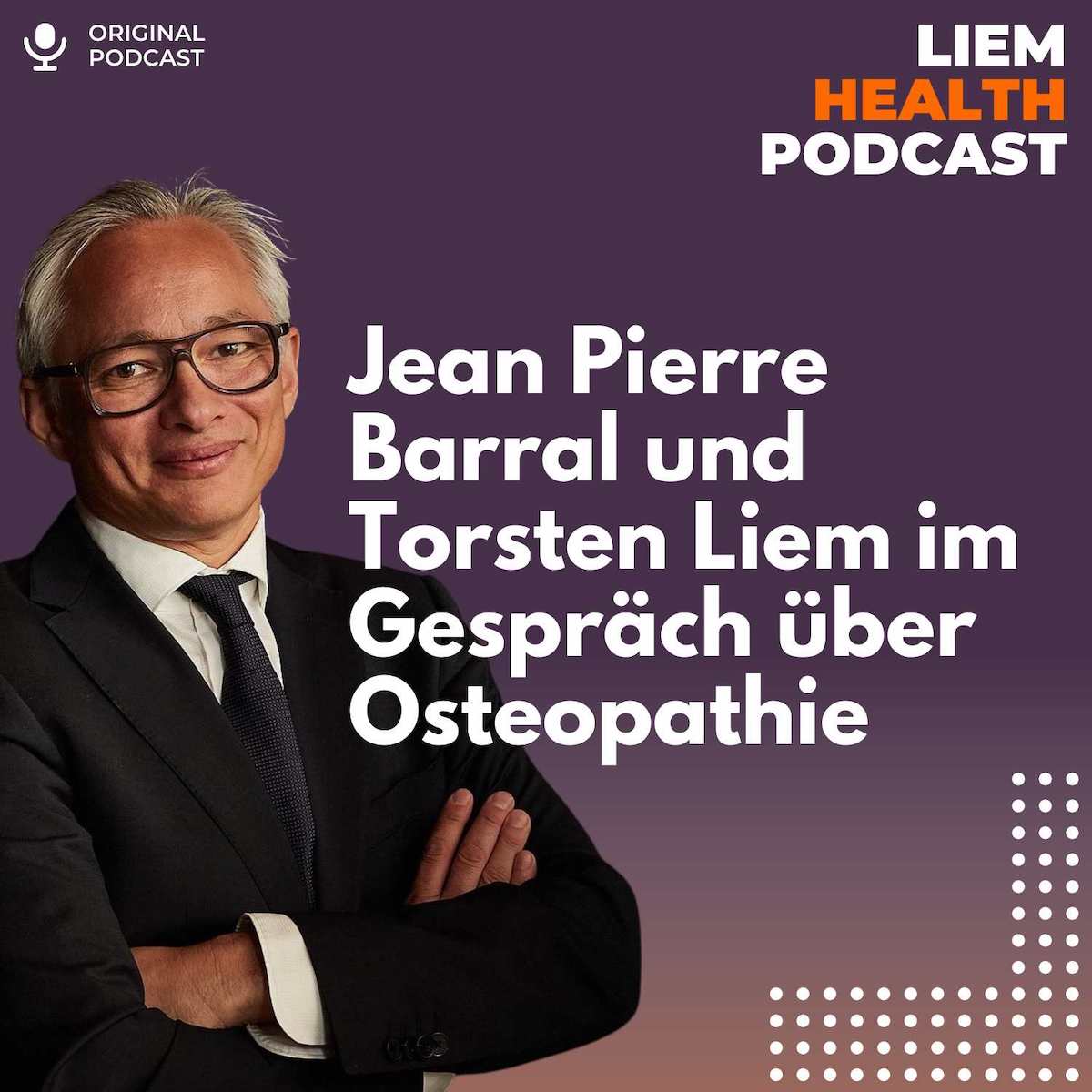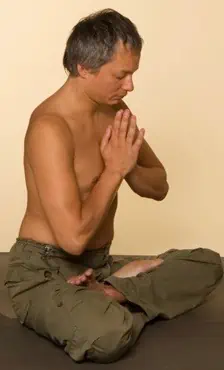Text: Inge Behrens – Fachliche Beratung: Torsten Liem, Normen Wolke. Ein Beitrag aus „naturlich gesund und munter“, Heft 6/25.
Kaum eine komplementäre Therapie verzeichnet so viel Zulauf wie die Osteopathie. Statt auf teure Apparate vertraut der Osteopath nur auf ein Werkzeug: seine Finger. Mit ihnen „lauscht“ er dem Körpergeschehen und löst Impulse zur Selbstheilung aus. Aber was macht er dabei genau? Und bei welchen Leiden kann eine osteopathische Behandlung helfen?
Selbst der gewissenhafteste Mediziner stößt manchmal an seine Grenzen. Klagt ein Patient über starke Nacken- und Rückenschmerzen oder Bewegungsstörungen, und auch mit bildgebenden Verfahren lässt sich keine Ursache finden, ist der Orthopäde mit seinem medizinischen Latein am Ende. Schreit ein Baby ununterbrochen, ist eine Kinderärztin oftmals genauso rat- und hilflos wie die Mutter. Und bei Herzrhythmusstörungen wissen auch Kardiologen mitunter keinen Rat.
„Geh doch mal zum Osteopathen“, lautet dann nicht selten die Empfehlung. Tatsächlich haben viele Deutsche das bereits gemacht: Laut einer Forsa Studie von 2024 waren 31 Prozent der Befragten oder ihr Kind mindestens einmal in einer osteopathischen Behandlung, das entspricht knapp 20 Millionen Deutschen. Dreiviertel der Befragten gaben an, mit der Behandlung zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein. Das zeige, dass die Osteopathie in der Bevölkerung angekommen sei, sagt der Osteopath Torsten Liem, der Gründer der Osteopathie-Schule Deutschland (OSD) in Hamburg. Dennoch ist es noch immer vielen ein Rätsel, was ein Osteopath macht. Manche meinen, er schicke – ähnlich wie beim Reiki – heilende Energie durch den Körper, weil es gelegentlich den Anschein hat, als ob der Osteopath nichts weiter tue, als die Hand auf eine Körperstelle zu legen. Andere meinen, er arbeite chiropraktisch und löse Gelenkblockaden. Während die erste Annahme schlichtweg falsch ist, stimmt die zweite, greift aber viel zu kurz. Denn diese Medizin, die den Menschen als Ganzes betrachtet, vereint viele verschiedene Ansätze. „Die Chiropraktik ist nur eine von vielen Methoden aus einer großen Toolbox, aus der sich ein Osteopath bedienen kann“, stellt Torsten Liem klar.
Weil alles mit allem zusammenhängt
Der Begriff Osteopathie setzt sich aus den altgriechischen Worten osteon = Knochen und pathos = Leiden zusammen. Der US-Amerikaner Andrew Taylor Still (1828–1917), der die Therapiemethode entwickelt hat, gab ihr diesen Namen. Schon als Kind wollte er verstehen, wie Bewegung funktioniert, und trug deshalb viele verschiedene Tierknochen in der Hosentasche, die er immer wieder ertastete (mehr zu den „Klugen Köpfe der Osteopathie“ siehe Kasten). Doch auch wenn Osteopathie wörtlich übersetzt „Knochenleiden“ heißt, beschäftigt sich ein Osteopath keineswegs nur mit den rund 200 Knochen des menschlichen Körpers. Der Begriff „Knochen“ steht stellvertretend für das gesamte Körpergewebe, denn der Osteopath behandelt auch die Muskulatur, die Gefäße, die Bänder und Sehnen, das weiche Bindegewebe und sogar die Organe.
Verbunden werden all diese Strukturen durch die Faszien und die Körperflüssigkeiten, angefangen von der Gehirn- und Rückenmarkflüssigkeit (Liquor) über die Lymphe bis hin zum Blut. Faszien sind ein faseriges, kollagenartiges, weißliches Bindegewebe, das den ganzen Organismus wie ein Netzwerk durchzieht und jede Struktur umhüllt – ob Gelenke oder Organe, ob Bänder, Muskeln oder Membrane. Sie machen Bewegung erst möglich und halten auch die Organe am Platz.
So wie eine minimale Berührung ein Spinnennetz in Bewegung bringt, kann eine Körperfaszie Veränderungen übertragen und somit ganz woanders Beschwerden auslösen. Eine Fehlstellung des Fußes kann deshalb beispielsweise Nacken- oder Hüftbeschwerden verursachen. „Wenn sich Gelenke verstellen, werden Kräfte unökonomisch abgeleitet. Ist das Gelenk bereits vorgeschädigt, kann es diese Extra-Arbeit nicht mehr leisten, und die Überlastung führt an anderer Stelle zu Belastungen, Schmerzen oder Funktionsverlusten“, erklärt der Berliner Osteopath Normen Wolke. Auch die Bewegung und Funktion der Organe kann sich verändern und über das fasziale Netzwerk Schmerzen im Rücken oder anderswo hervorrufen. Denn die Organe sind über diese Bindegewebshüllen mit der Rumpfwand verbunden und an der Wirbelsäule aufgehängt.
Auch die Körperflüssigkeiten spielen in der Osteopathie eine große Rolle. Bevor die Therapeuten Blockaden lösen, ertasten sie die feine Bewegung der Hirn- und Rückenmarkflüssigkeit, die beständig zwischen Schädel und Kreuzbein fließt, denn sie gehen davon aus, dass sich dieser Rhythmus auf den ganzen Körper auswirkt.
Der gesamte Körper wird „gelesen“
Weil für den Osteopathen immer alles mit allem zusammenhängt, schaut er mit weitem Blick auf das Körpergeschehen. „Wir versuchen, die Wirkmechanismen zwischen den einzelnen Systemen zu verstehen“, sagt Torsten Liem. Aus Sicht eines Osteopathen beeinflussen alle physiologischen Prozesse und Systeme die knöchernen und faszialen Körperstrukturen. Dazu gehören die Körperhaltung und Bewegung, die Atmung und das Herz-Kreislauf-System, der Stoffwechsel, das Immun- und Hormonsystem sowie das Nervensystem mit dem Gehirn, den Sinnesorganen und dem autonomen Nervensystem.
Um herauszufinden, ob eines dieser fünf Systeme im Ungleichgewicht ist, beginnt ein Osteopath mit der Inspektion, sobald ein Patient durch die Tür kommt. Anpassungsreaktionen seien nämlich nicht nur im Gewebe zu lesen, sondern auch in der Mimik, in der Körperhaltung, in der Gestik, im Gangbild und nicht zuletzt in der Atmung und in der Sprache, so Liems Erfahrung. „Ich schaue mir deshalb an, wie der Gang und die Schrittlänge eines Patienten sind, wie flüssig und wie gut koordiniert er sich bewegt, ob er Augenkontakt sucht und hält und ob seine Atmung regelmäßig ist.“ Die Fähigkeit, dieses Wechselspiel „lesen“ zu können, sei mitentscheidend für die Qualität einer anschließenden osteopathischen Behandlung, schreiben Torsten Liem und Christine Tsolodimos in ihrem aktuellen Gemeinschaftswerk „Das Osteopathie-Selbsthilfe-Buch“ (Trias Verlag).
Im anschließenden Gespräch erkundigt sich der Osteopath nach Beschwerden und befragt den Patienten nach dem Lebensstil, also nach Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten sowie nach gesundheitsfördernden Faktoren und Ressourcen, aber auch nach Operationen, der Krankenvorgeschichte und psychischen Belastungen. Auch krankmachende Faktoren aus der Umwelt fließen in die Betrachtung mit ein. Ob Schadstoffe, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung oder seelische Probleme, ob zu viel oder zu wenig Sonne – all diese Faktoren können einen Organismus belasten.
„Der Trigger für ein Leiden kommt fast immer aus dem Kontext des Patienten“, ist Liem überzeugt. Der Körper ist sehr anpassungsfähig und lange Zeit in der Lage, die physiologischen Körperfunktionen so zu regulieren, dass sie im Gleichgewicht bleiben. Aber ab einem bestimmten Punkt verliert der Organismus seine Fähigkeit zur Selbstregulierung, und die chronischen Belastungen führen zu Krankheit, Beschwerden oder auch zu vorzeitiger Alterung.
Nach diesem vorbereitenden Gespräch fragt der Osteopath aktive und passive Bewegungsmuster ab und bittet beispielsweise einen Patienten, der an Rückenschmerzen im Lendenbereich leidet, sich nach vorn und nach hinten zu beugen. Zum Schluss untersucht er, wie gut sich ein Körperglied, etwa ein Oberschenkel, passiv anwinkeln lässt, ob Nerven gedehnt werden können und ob Reflexzonen spürbar sind oder Asymmetrien vorliegen.
Jedes Gewebe erzählt eine Geschichte
Die entscheidenden Indizien liefert das Körpergewebe selbst. Sowohl zur Diagnose als auch für die Behandlung benutzt der Osteopath nur ein einziges Werkzeug: seine Hände. Denn jedes Gewebe hat seine eigene Geschichte, die es erzählen kann. Um sie zu verstehen, „lauscht“ der Osteopath quasi mit seinen Fingern. Wie ein Detektiv sucht er tastend nach dem Auslöser der Schmerzen beziehungsweise der Bewegungs- oder Funktionsstörung. „Die Hand ist dabei wie eine Lampe, die den Körper für den Behandler durchlässig erscheinen lässt: die Haut, Muskeln, Knochen, Gefäße, Nerven und Organe“, so veranschaulicht Torsten Liem diesen für Außenstehende geheimnisvoll anmutenden Vorgang. Die hohe Kunst dabei ist, beim Ertasten gesundes und dysfunktionales Gewebe unterscheiden zu können. Die Finger nehmen dabei nicht nur zu viel oder zu wenig Spannung wahr, sondern auch Gewebeveränderungen wie einen Mangel an Elastizität und Verschiebbarkeit, Asymmetrien oder Druckempfindlichkeit. „Palpation“, so nennen Osteopathen dieses vorsichtige Ertasten von Körperstrukturen.
Die anschließende Behandlung kann die so erfühlte Diagnose füttern oder verändern. „Während ich eine Behandlung ausführe, führe ich andauernd ein Zwiegespräch mit dem Gewebe und der gesamten Person“, erklärt Liem. So gesehen sei der Osteopath ein Beziehungstherapeut. „Ich spüre immer auch zugleich, wie der Körper an der behandelten Stelle auf die Technik reagiert. Atmet der Patient plötzlich schneller, runzelt er die Stirn oder verändert sich das Gewebe, das ich gerade behandele?“
Wirksamkeit auf dem Prüfstand
Das Osteopathie Research Institut untersucht derzeit die Wirksamkeit der psychosomatischen Osteopathie, bei der Patienten aktiver in die Behandlung miteinbezogen werden. 200 Osteopathen sind an der Studie beteiligt. Im Bereich der Kinderosteopathie belegen systematische Reviews zumindest bei Schreikindern, dass die Osteopathie wirksam ist. Gerade bei Babys und Kleinkindern ist es wichtig, früh dysfunktionale Bewegungsmuster oder Reflexmuster zu erkennen und zu behandeln. Andere Studien ergaben, dass osteopathische Behandlungen bei Angst- und Stresserkrankungen sowie bei Depressionen helfen können. Eine Studie von 2021 belegte zudem die positiven Effekte bei nicht spezifischen Rücken- und Nackenschmerzen. Dass die Osteopathie auch sehr gut begleitend zur schulmedizinischen Behandlung angewandt und diese positiv beeinflussen kann, zeigte eine Untersuchung, bei der Patienten vor und nach einer Bypass-OP osteopathisch behandelt wurden und die Herzratenvariabilität gemessen wurde.
Psychosomatische Osteopathie
Vertreter dieser noch jungen, vom Hamburger Osteopathen Torsten Liem begründeten Fachrichtung der Therapiemethode sehen Körper und Seele als eine bis ins Innerste verwobene Einheit an und gehen zum Beispiel davon aus, dass sich Funktionsstörungen der Gewebe in bestimmten Bewusstseinsmustern widerspiegeln und umgekehrt. Sie sprechen der Bewusstheit, der Haltung, dem Verhalten und dem individuellen Potenzial des Patienten, selbst an seiner Genesung mitzuwirken, eine zentrale Rolle im Heilungsprozess zu. Dadurch nimmt der Patient in dieser Behandlung eine aktivere Rolle ein als sonst in der Osteopathie üblich.
Osteopathie: Hilfe zur Selbsthilfe
Entwickelt wurde das Bild des Körpers, bei dem alles konstant in Bewegung ist und zueinander in Beziehung steht, Mitte des letzten Jahrhunderts von dem Landarzt Andrew Taylor Still, dem Mann mit den Knochen in der Hosentasche. Er formulierte die Prinzipien der Osteopathie und übertrug deren Grundsätze und Praktiken in ein komplett neues Medizinsystem. Im Laufe der Jahre haben sich daraus drei unterschiedliche Richtungen der Osteopathie entwickelt: Während sich die parietale Osteopathie primär den Störungen des Bewegungsapparates, also den Knochen und Gelenken, widmet, befasst sich die viszerale Osteopathie mit den inneren Organen und der mit Bindegewebe ausgestatteten Körperhöhle. Die craniosacrale Osteopathie wiederum bezieht sich auf die Spannung der Membranen im Kopf- und Rückenmarksbereich und legt den Fokus auf Schädel, Rückenmark, Kreuzbein und tiefe Membranen des Gehirns inklusive der Flüssigkeitsebenen mit Liquor.
Auch heute noch gilt in der Osteopathie Andrew Taylor Stills philosophischer Grundsatz, dass der menschliche Körper die Kraft hat, sich selbst zu heilen. Oft bedarf es nur einiger sanfter manueller Impulse, um die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Rund 3000 verschiedene Handgriffe und Methoden lernt ein Osteopath während seiner mehrjährigen Ausbildung. Manche Handgriffe sind craniosacral, einige biomechanisch strukturell und andere biodynamisch oder viszeral. Es gibt spezielle Techniken, um Narbengewebe, aber auch Muskelpunkte und schmerzempfindliche Punkte – sogenannte Tenderpoints – zu behandeln, andere Techniken werden für Bewegungsstörungen eingesetzt oder um Faszien zu dehnen. Doch alle dienen demselben Ziel: die Freiheit des Gewebes wiederherzustellen.
Was das in der Praxis bedeutet, erläutert der Berliner Osteopath Normen Wolke am Beispiel eines 45-jährigen Patienten, der bei Behandlungsbeginn seit drei Monaten beim Joggen Schmerzen im Vorfuß hatte. Bei der Anamnese stellte sich heraus, dass dem Patienten vor 15 Jahren der Blinddarm entfernt worden war. Die palpatorische Untersuchung der knöchernen Strukturen und der Organe im inneren Teil des rechten Beckens ergab, dass die Narbe mit dem Beginn des Dickdarms verwachsen war. Sowohl das Iliosakral- als auch das Hüftgelenk waren dadurch etwas eingeschränkt, was zur Überlastung und den Beschwerden des Vorfußes geführt hatte. Eine zweimalige Behandlung der viszeralen Strukturen sowie eine Massage der verwachsenen Narbe und Mobilisation des Hüftgelenks brachte die erwünschte Wirkung. Nach drei Wochen konnte der Patient wieder schmerzfrei joggen.
Osteopath, demnächst ein anerkannter Heilberuf?
Die Osteopathie hat sich von Beginn an nicht nur als eine Heilkunst, sondern auch als eine Philosophie und eine Wissenschaft verstanden. Ob diese alternative Medizin allerdings wirklich helfen, geschweige denn heilen kann, ist wissenschaftlich umstritten. Kritiker monieren, die Forschungs- und Evidenzlage sei unzureichend. Zwar gibt es einige neuere Studien, doch diese sind meist sehr klein.
Zwar ist die Osteopathie als Heilberuf nicht anerkannt und ihre Wirksamkeit nicht ausreichend erforscht, dennoch bezuschussen einige private und gesetzliche Krankenkassen eine osteopathische Behandlung. Torsten Liem kritisiert, der Markt sei unglaublich unreguliert. Da die Bezeichnung nicht geschützt ist, kann sich jeder Osteopath nennen. So würden beispielsweise Ausbildungen in Kinderosteopathie von Personen angeboten, die selbst keinen Abschluss in Osteopathie haben, berichtet Liem. Um dem entgegenzuwirken, hat er schon im Jahr 1999 seine Osteopathie-Schule gegründet, die mittlerweile über Lehrpraxen in Hamburg, Berlin und München verfügt. Obwohl er einen Master in Osteopathie und einen Master in Kinderosteopathie vorweisen kann, musste er zusätzlich eine Heilpraktikerausbildung abschließen, um eine staatliche Heilerlaubnis zu erlangen. Bisher sind nur Ärzte davon ausgenommen.
Doch schon bald könnte sich das ändern: Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung steht, dass die Osteopathie berufsgesetzlich geregelt werden soll. Im Sinne der Qualitätssicherung findet Liem es wichtig, dass endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen seiner Berufsgruppe festgelegt und auch die Ausbildung strukturiert werden sollen. Vielleicht vertrauen dann noch mehr Patienten auf die besonderen manuellen Fähigkeiten des Osteopathen, diesen „thinking, feeling, knowing fingers“. Zaubern können sie zwar nicht, aber manchmal reichen drei bis fünf Behandlungen, und selbst langjährige Beschwerden lassen spürbar nach.
Kluge Köpfe hinter der Osteopathie
Die Osteopathie ist kein fest gefügtes Medizinsystem. Sie entwickelt sich seit ihren Anfängen Mitte des letzten Jahrhunderts ständig weiter:
- Andrew Taylor Still (1828–1917) gilt als Begründer der Osteopathie. Seine erste osteopathische Entdeckung machte er bereits mit zehn Jahren. Damals wollte er an einem Tau, das er an einen Baum geknüpft hatte, schaukeln. Weil er Kopfweh hatte, ließ er das Seil so weit herunter, bis es nur noch 25 Zentimeter über dem Boden baumelte, warf ein Leintuch über die Schlaufe, streckte sich lang auf den Boden aus und legte seinen Nacken auf dem beweglichen Kissen ab. Schon wenig später ging es ihm besser. Dieses Erlebnis wirkte in dem späteren Arzt nach. Er begann seine Kenntnis in funktioneller Anatomie zu perfektionieren und entwickelte daraus ein umfassendes Konzept, die Osteopathie.
- William Garner Sutherland (1873–1954), US-Amerikaner und Schüler von Andrew Still, erweiterte das Konzept der Osteopathie um die craniosacrale Therapie. Er prägte den Satz: Der Osteopath ist eine Person, die mit fühlenden, sehenden, denkenden und wissenden Händen arbeitet.
- Jim Jealous (1943–2021), ebenfalls aus den USA, hat die biodynamische Osteopathie entwickelt, die wiederum auf der craniosacralen Therapie basiert. Er bezog neben der Gehirn- und Rückenmarkflüssigkeit, Liquor genannt, auch die Lymphe und das Blut mit in die Behandlung ein, weil er annahm, dass es überall da zu Beschwerden kommen kann, wo Flüssigkeit nicht in Bewegung ist.
- Jean-Pierre Barral (1944), französischer Osteopath, ist als Begründer der viszeralen Therapie einer der berühmtesten Vertreter der Osteopathie. Seine Theorie: Organe müssen frei beweglich sein, damit sie gut funktionieren. Sind die Organhüllen mit dem umliegenden Gewebe verwachsen oder Organe nach OPs vernarbt, kann das nicht nur weitreichende Folgen für den Körper haben, sondern auch die Emotionen verändern. In jahrelanger Forschung und klinischer Arbeit wies er die Zusammenhänge von Organ und Gelenk nach, etwa von Leber und rechter Schulter oder Blase und Hüftgelenk. Mithilfe der viszeralen Manipulation verbessern sich die Eigenbewegung, die Durchblutung und Innervation eines Organs, gleichzeitig wird die Spannung im Bindegewebe gelöst, die sich auf Muskeln und Knochen überträgt.